- Home
- Diagnose
- Blutuntersuchung
- Blutwerte
Blutwerte: Die 11 wichtigsten Werte und ihre Bedeutung
Verschiedene Blutwerte sind wichtige Parameter für die Gesundheit. Welche Werte sind aussagekräftig und sollten regelmäßig überprüft werden, um gesund zu bleiben? Nicht alle Werte werden in einem Blutbild erfasst, können aber auf Selbstzahlerbasis bestimmt werden.
Die einzelnen Blutwerte können von Labor zu Labor leicht abweichen. Der Grund: Beim Messen kommen verschiedene Geräte zum Einsatz. Diese Abweichungen sind allerdings minimal.
Wir erklären die 11 wichtigsten Werte im Blut kurz und übersichtlich in der Bildergalerie.

Blutwert: Erythrozyten
Die Erythrozyten (roten Blutkörperchen) erhalten ihre Farbe durch ihren Blutfarbstoff Hämoglobin. Hämoglobin ist in der Lage, Sauerstoff zu binden. Daher sagt die Menge der roten Blutkörperchen aus, wie gut der Körper mit Sauerstoff versorgt werden kann.
Wie hoch der Anteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin ist, zeigt der Hämoglobin-Wert an. Da Hämoglobin Bestandteil der roten Blutkörperchen ist, sind meist beide Werte parallel erhöht, erniedrigt oder im Normalbereich.

Erythrozyten-Wert zu hoch
Ist die Zahl der roten Blutkörperchen erhöht (sog. Polyglobulie), liegt dies oft daran, dass nicht ausreichend Sauerstoff in den Körper gelangt. Dies kann beispielsweise passieren, wenn man sich im Hochgebirge aufhält. Den Sauerstoffmangel versucht der Körper auszugleichen, indem er vermehrt rote Blutkörperchen herstellt.
Auch Lungen- und Herzkrankheiten sowie die Polycythaemia vera, eine Erkrankung des Knochenmarks, führt ebenfalls zu einer Überproduktion von roten Blutkörperchen.
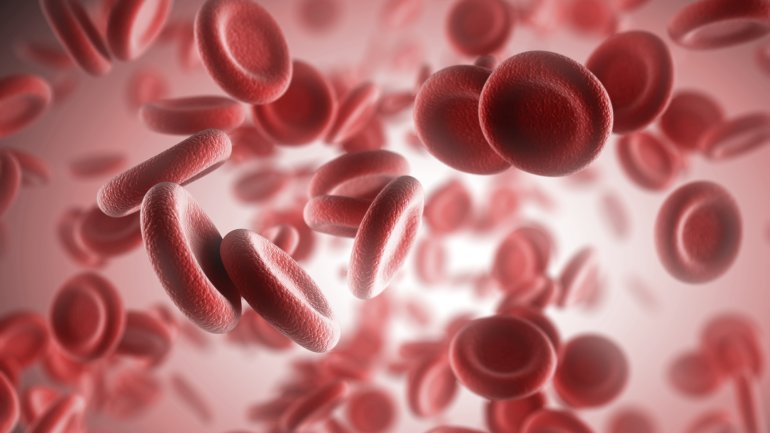
Hämoglobin-Wert zu niedrig
Hämoglobin ist das Maß der Sauerstofftransportkapazität im Blut. Ein zu niedriger Blutwert kann durch eine Eisenmangelanämie verursacht werden, aber auch ein Zeichen für einen Vitamin-B12-Mangel, einen Folsäuremangel oder für Aminosäurendefizite sein. Allerdings kann auch ein hoher Blutverlust dazu führen, dass zu viele rote Blutkörperchen verloren gehen, sodass es zur Blutarmut kommt.

Erhöhter Hämatokrit-Wert
Der Hämatokrit-Wert gibt an, wie viele feste und wie viele flüssige Bestandteile im Blut vorhanden sind, sprich: wie "dick" das Blut ist. Der Blutwert hängt vor allem von der Menge der roten Blutkörperchen ab, denn diese machen den größten Anteil der Blutzellen aus.
Ein hoher Hämatokrit-Wert bedeutet, dass viele feste Bestandteile im Blut sind. Das Blut ist also relativ dickflüssig, was bedeutet, dass es schlechter fließen kann. "Dickes Blut" erhöht das Risiko für Blutgerinnsel (Thrombose). Im Umkehrschluss bedeutet ein niedriger Wert einen guten Blutfluss.
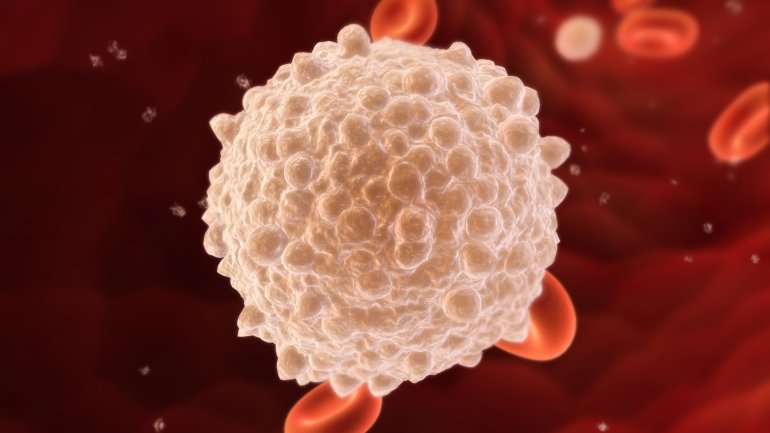
Zu hohe Leukozyten-Werte
Die Leukozyten (weißen Blutkörperchen) sagen etwas über mögliche Infektionen oder Entzündungen im Körper aus – denn sie werden produziert, um Krankheitserreger abzuwehren. Zu den Leukozyten gehören Granolozyten, Monozyten und Lymphozyten. Zu hohe Leukozyten-Werte deuten auf einen akuten oder chronischen Infekt hin, sind aber auch bei Raucher*innen erhöht.

Leukozyten: zu niedrige Werte
Sind die Blutwerte der Leukozyten zu niedrig, können die Ursachen ebenfalls vielfältig sein. Hierzu zählen etwa viele Virusinfektionen, aber auch Knochenmarkschädigungen, verschiedene Medikamente (z. B. Antibiotika, Zytostatika), Bestrahlungen oder Autoimmunerkrankungen.

Lymphozyten: zu hohe Werte
Eine erhöhte Lymphozytenanzahl im Blut kann verschiedene Ursachen haben. Werte über der Norm können z. B. auf Virusinfektionen und einige bakterielle Erkrankungen hinweisen (etwa Tuberkulose). Auch eine lymphatische Leukämie geht mit zu vielen Lymphozyten einher.

Lymphozyten: zu niedrige Werte
Zu wenig Lymphozyten befinden sich vor allem dann im Blut, wenn das Lymphsystem geschädigt ist – beispielsweise durch Strahlung, Vergiftungen, Medikamente oder Erreger wie HIV. Auch Erkrankungen wie Morbus Hodgkin oder das Cushing-Syndrom können für eine niedrige Lymphozytenzahl im Blutbild verantwortlich sein.
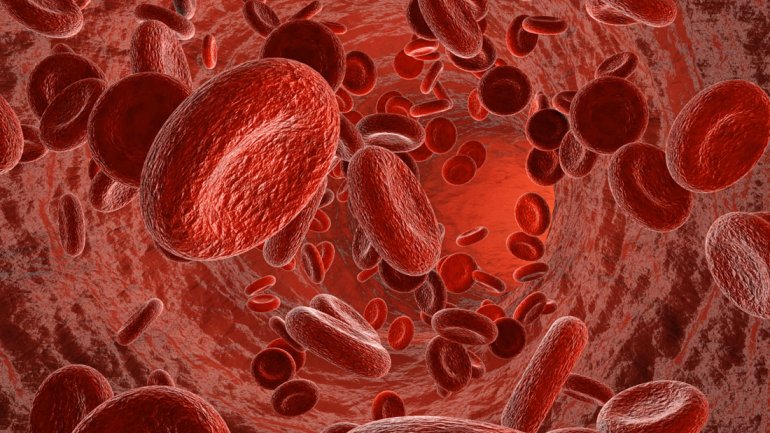
Blutwerte: Cholesterin
Der Cholesterinwert (gesamt) im Blut sollte bei gesunden Menschen unter 200 mg/dl (5,2 mmol/l) liegen. Liegt er dauerhaft darüber, sprechen Fachleute von einer Hypercholesterinämie, die das Risiko für Arteriosklerose und Herz-Kreislauferkrankungen erhöht.
Das Gesamtcholesterin setzt sich aus LDL, HDL und Triglycerin zusammen. Der LDL-Wert zeigt die Menge der "schlechten" Fette, der HDL-Wert die der "guten" Fette im Blut.

Blutfettwerte: Triglyzeride
Neben den HDL- und LDL-Werten sind bei den Blutfettwerten die Triglyzeride ein wichtiger Blutwert. Triglyceride sollten unter 150 mg/dl (1,7 mmol/l) liegen. Sind sie dauerhaft erhöht, kann dies ein Hinweis auf eine Insulinresistenz sein, aus der sich Diabetes mellitus entwickeln kann.
Lesetipp: 12 Tipps, um die Triglyceride zu senken

Blutwert: C-reaktives Protein (CRP) erhöht
Das C-reaktives Protein (CRP) ist ein wichtiger Wert im Blut, der Auskunft über im Körper vorliegende Entzündungen gibt. Der CRP-Wert steigt bei akuten Infekten stark an. Bei chronischen Entzündungen ist er leicht erhöht und kann deshalb einen Hinweis auf eine unbemerkte, stille Entzündung im Körper geben.
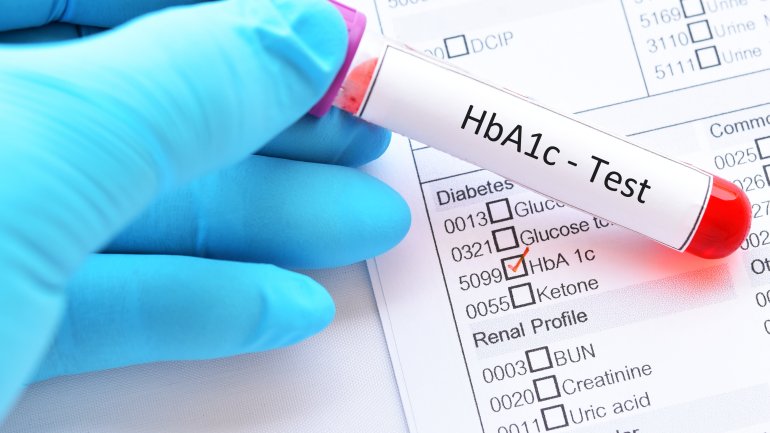
Blutwert: HbA1c
Der Blutwert HbA1c ist das sogenannte Blutzuckergedächtnis. Er zeigt den Durchschnitt der Blutzuckerwerte der letzten drei Monate und gibt Auskunft darüber, ob Diabetes besteht. Bei Diabetiker*innen wird er regelmäßig bestimmt, um die Einstellung des Blutzuckers zu überwachen.
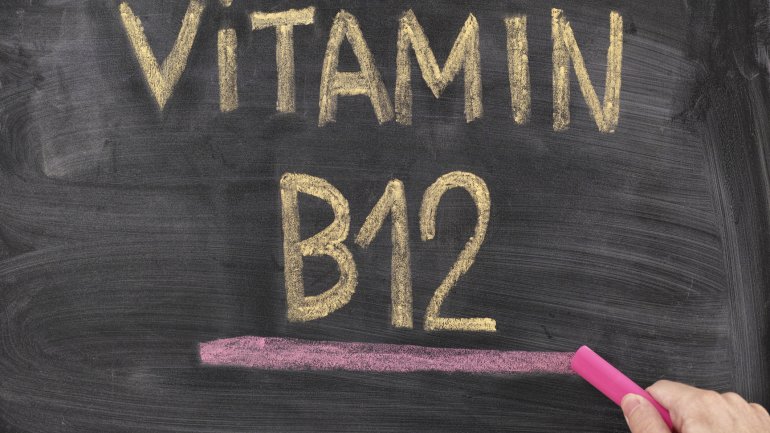
Blutwert: Vitamin B12
Auch Mikronährstoffe können im Blut untersucht werden. Besonders aussagekräftig ist der Vitamin-B12-Wert. Dieser Mikronährstoff ist unter anderem für die Immunabwehr, Blutbildung, die Hormonproduktion und die Nervenfunktion wichtig. Besonders Menschen, die sich vegan ernähren, sollten diesen Wert regelmäßig kontrollieren lassen, da sie für einen Mangel gefährdet sind und Vitamin-B12 extra zuführen sollten.
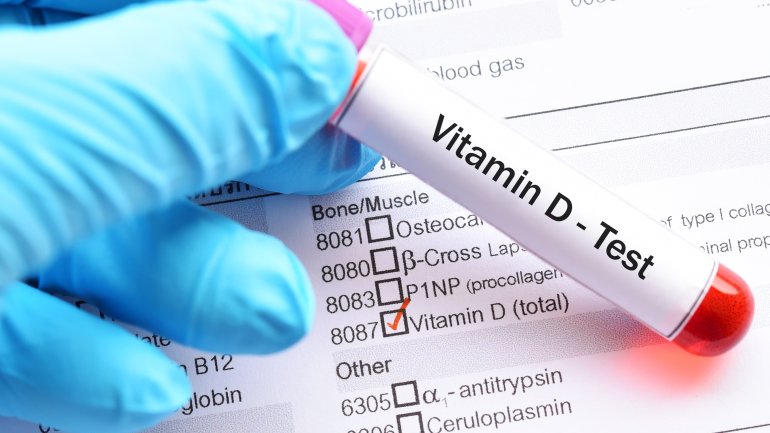
Blutwert: Vitamin D
Auch der Vitamin-D-Wert im Blut ist ein wichtiger Wert für die Gesundheit. Vitamin D ist unter anderem für die Knochenstabilität und den Zahnerhalt zuständig. Auch an vielen weiteren Stoffwechselvorgängen ist es beteiligt. Da viele Menschen unter einem Vitamin-D-Mangel leiden, ist auch hier die regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls die Einnahme von speziellen Präparaten sinnvoll, vor allem im Winter, wenn der Körper es aufgrund mangelnder Sonneneinstrahlung nicht selber bilden kann.
Verschiedene Blutwerte sind wichtige Parameter für die Gesundheit. Welche Werte sind aussagekräftig und sollten regelmäßig überprüft werden, um gesund zu bleiben? Nicht alle Werte werden in einem Blutbild erfasst, können aber auf Selbstzahlerbasis bestimmt werden.
Die einzelnen Blutwerte können von Labor zu Labor leicht abweichen. Der Grund: Beim Messen kommen verschiedene Geräte zum Einsatz. Diese Abweichungen sind allerdings minimal.
Wir erklären die 11 wichtigsten Werte im Blut kurz und übersichtlich in der Bildergalerie.
- Herold, G.: Innere Medizin. Selbstverlag, Köln 2022
- Online-Informationen des Pschyrembels: https://www.pschyrembel.de/ (Abruf: 09/2022)
- Deschka, M.: Laborwerte A-Z. Kohlhammer, Stuttgart 2011
- Online-Informationen von Deximed: https://deximed.de (Abruf: 09/2022)
























