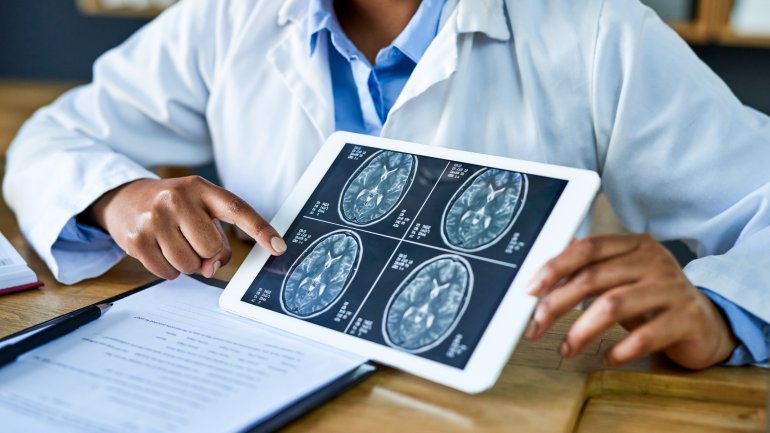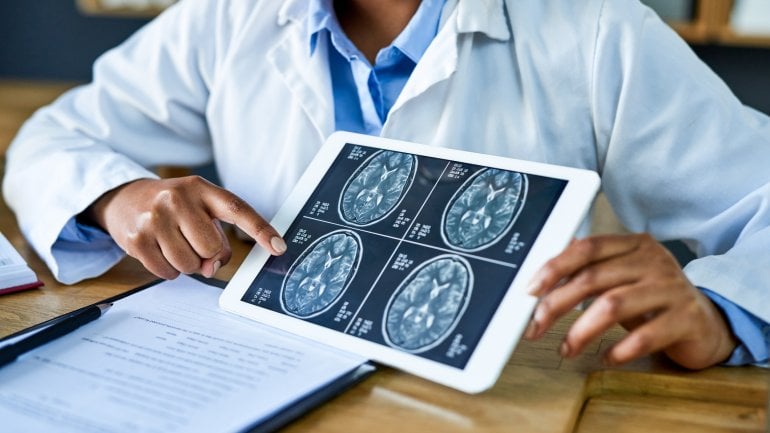Hirntumor: Arten, Anzeichen und Behandlung
Kopfschmerzen, Schwindel, Wesensveränderungen: Diese Symptome können viele Ursachen haben. Relativ selten steckt bei Erwachsenen ein Hirntumor dahinter. Im Kindesalter sind Hirntumoren verhältnismäßig häufig – aber oft auch gut behandelbar. Erfahren Sie, welche Arten von Hirntumoren es gibt und wie die Behandlung erfolgt.
Dieser Text entspricht den Vorgaben der ärztlichen Fachliteratur, medizinischen Leitlinien sowie aktuellen Studien und wurde von Mediziner*innen geprüft.
FAQ: Fragen und Antworten zum Thema Hirntumor
Heutzutage ist es in vielen Fällen möglich, Hirntumoren vollständig zu heilen. Dazu zählen insbesondere gutartige Meningeome, Neurinome oder Lymphome. Bei anderen Formen wie einem Gliom gibt es wesentliche medizinische Fortschritte, eine vollständige Heilung ist jedoch nicht immer möglich.
Hirntumoren können Menschen jeden Alters betreffen. Häufig sind Betroffene zwischen 50 und 70 Jahre alt. Spezielle Arten wie etwa bösartige Medulloblastome oder gutartige Gliome entstehen öfters bei Kindern.
Da nicht bekannt ist, was einen Hirntumor verursacht, gibt es auch kaum Möglichkeiten, ihm vorzubeugen. Da bestimmte seltene Erbkrankheiten das Risiko erhöhen, sollten betroffene Familien regelmäßige Kontrolluntersuchungen wahrnehmen.
Was ist ein Hirntumor?
Bei einem Hirntumor handelt es sich um ein gutartiges oder bösartiges Geschwulst, das innerhalb des Schädels entstehen kann. Hirntumoren können sich direkt im Gehirngewebe oder den Hirnhäuten bilden, was als primärer Hirntumor bezeichnet wird. Bei sekundären Hirntumoren liegen Metastasen im Gehirn vor, die von einem anderen ursprünglichen Tumor im Körper ausgehen.
Häufigkeit von Gehirntumoren
Insgesamt zählen Hirntumoren zu den seltenen Tumorerkrankungen. Sie machen etwa zwei Prozent aller Krebserkrankungen aus. Rund 18 von 100.000 Erwachsenen und 3 von 100.000 Kindern erkranken jährlich daran. Männer sind etwas häufiger von bösartigen Tumoren und Hirnmetastasen betroffen als Frauen.
Nach Leukämie zählen Tumoren des Hirns zu den zweithäufigsten Krebserkrankungen bei Kindern. Der häufigste bösartige Hirntumor bei Kindern ist das Medulloblastom.
Hirntumoren: Einteilung und Arten
Es gibt unterschiedliche Hirntumoren. Manche bestehen aus Nervenzellen, andere aus Fettgewebe. Manche wachsen besonders rasch, andere breiten sich nur langsam aus. Einige sind zunächst gutartig, können jedoch entarten. Für eine optimale Therapie ist es für die*den Ärztin*Arzt wichtig zu wissen, welche Eigenschaften der Tumor hat. Dabei spielen verschiedene Merkmale eine Rolle, vor allem
- aus welchem Gewebe der Tumor besteht,
- ob der Tumor gut- oder bösartig ist und
- wie rasch der Tumor wächst (Tumorgrad).
Je nachdem, von welchem Gewebetyp der Tumor ausgeht, sprechen Fachleute von Tumoren des Zentralen Nervensystems (ZNS). Dazu zählen Tumoren
- im Gehirn,
- im Rückenmark
- in den Rücken- und Rückenmarkshäuten
- und den Hirnnerven.
Gutartige und bösartige Hirntumoren
Darüber hinaus unterscheiden Fachleute zwischen gutartigen und bösartigen Hirntumoren:
Ein gutartiger Gehirntumor wächst nur langsam und bleibt dabei meist von benachbartem, gesundem Hirngewebe gut abgrenzbar.
Ein bösartiger Gehirntumor nimmt dagegen häufig schnell an Größe zu und wächst dabei zerstörerisch in das umgebende Gewebe hinein (infiltratives Wachstum).
Gutartige Hirntumoren wie Akustikusneurinome oder Astrozytome
Zur Gruppe der gutartigen Hirntumoren gehören beispielsweise:
- Kraniopharyngeome
- Neurinome, zum Beispiel Akustikusneurinom
- Hypophysenadenome (Tumoren der Hirnanhangdrüse)
- niedriggradige Astrozytome (z. B. das pilozytische Astrozytom)
Bösartige Hirntumoren wie Medulloblastome oder Oligodendrogliome
In die Kategorie der bösartigen Hirntumoren fallen beispielsweise:
- anaplastische Astrozytome, Glioblastome
- Medulloblastome
- Oligodendrogliome
Hirntumor: Anzeichen und Symptome
Ein Gehirntumor kann unterschiedliche Symptome verursachen. Die Beschwerden können einzeln, aber auch in Kombination auftreten.
Häufige Symptome eines Hirntumors sind:
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Übelkeit
- Erbrechen
- Wesensveränderungen, Betroffene sind häufig schneller reizbar oder aggressiv
- Bewusstseinsstörungen
- Vergesslichkeit und Konzentrationsstörungen
- Lähmungserscheinungen
- Koordinations- und Gangstörungen
- epileptische Anfälle (Krampfanfälle), unkontrolliertes Zucken eines Körperteils
- Riechstörungen
- Sprachstörungen
- neurologische Ausfälle, etwa mit Sensibilitäts- und Schluckstörungen
Wichtig: Wer derartige Symptome bei sich oder einer anderen Person bemerkt, sollte ärztlichen Rat einholen. Es gibt viele weitere, harmlose Ursachen, die ebenso Auslöser sein können. Neu auftretende oder sich veränderte Kopfschmerzen sollten grundsätzlich immer ärztlich untersucht werden.
Hirntumor: Ursachen und Risikofaktoren
Bisher ist noch nicht abschließend erforscht, warum bei manchen Menschen ein Tumor im Gehirn entsteht oder welche Ursachen zur Erkrankung führen. Fachleute vermuten, dass sie sich zufällig bilden.
Zudem ist es noch nicht ausreichend wissenschaftlich belegt, ob
- bestimmte Lebensgewohnheiten wie etwa Rauchen und Alkoholkonsum oder
- Umwelteinflüsse, etwa schädigende Substanzen,
die Wahrscheinlichkeit, an einem Tumor im Gehirn zu erkranken, erhöhen.
In sehr seltenen Fällen ist das Risiko aufgrund eines genetischen Defekts erhöht. So treten etwa bei der Neurofibromatose (Morbus Recklinghausen) bestimmte Hirntumoren infolge eines genetischen Defekts häufiger auf.
Nach einer Chemotherapie oder einer radioaktiven Bestrahlung im Kindesalter ist das Risiko für einen Gehirntumor ebenfalls leicht erhöht.
Wie wird ein Hirntumor diagnostiziert?
Der Verdacht auf einen Hirntumor erfordert verschiedene Untersuchungen. Zunächst werden im ärztlichen Gespräch einige Fragen zu den genauen Symptomen gestellt. Dann schließen sich weitere Kontrollen an.
Eine entscheidende Rolle bei der Diagnose eines Hirntumors spielen die sogenannten bildgebenden Methoden. Dazu zählen:
- Magnetresonanztomographie (MRT) mit und ohne Kontrastmittel
- Magnetresonanz-Spektroskopie (MRS)
- Computertomographie (CT)
- Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
Diese Verfahren können durch weitere Untersuchungen ergänzt werden, wie:
- Lumbalpunktion mit Untersuchung des Nervenwassers (Liquor)
- Elektroenzephalographie (EEG): Messung der Hirnströme, was insbesondere bei Krampfanfällen bedeutend ist
- Angiographie: Röntgenuntersuchung der Blutgefäße im Gehirn mithilfe von Kontrastmittel
- Untersuchung des Augenhintergrunds (Ophthalmoskopie)
- Gewebeprobe (Biopsie), um herauszufinden, aus welchem Gewebe der Tumor besteht
Hirntumor: Wie erfolgt die Behandlung?
Die genaue Therapie eines Hirntumors ist individuell und wird von Fachleuten und Patient*innen gemeinsam entschieden. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Operation des Gehirntumors ein. Daneben können auch eine Strahlentherapie und Chemotherapie zum Einsatz kommen – auch in Kombination. Darüber hinaus gibt es viele weitere Therapiemöglichkeiten. Einige von ihnen werden noch in klinischen Studien getestet, andere können zusätzlich angeordnet werden.
Welche Behandlung infrage kommt, hängt von mehreren Faktoren ab, wie
- der Art des Tumors,
- dem Tumorgrad,
- der Lage und Größe des Tumors,
- dem allgemeinen Zustand der betroffenen Person,
- möglichen Vorerkrankungen und
- dem Alter der Patient*innen.
Operation eines Hirntumors
In vielen Fällen ist die Operation der erste Behandlungsschritt. Dabei wird zum einen Gewebe entnommen, um den Tumor noch genauer zu untersuchen. Zum anderen entfernen Ärzt*innen so viel Tumorgewebe wie möglich, ohne dabei Gehirnschäden zu verursachen. Doch nicht immer kann Tumorgewebe vollständig entfernt werden.
Bei bösartigen, zerstörerisch ins Hirngewebe einwachsenden Tumoren ist in der Regel keine vollständige Tumorentfernung möglich. Dies ist unter anderem beim Glioblastom und den vielen Astrozytomen der Fall. Dennoch kann eine Operation hilfreich sein, um den Tumor zu verkleinern. Das mindert den Hirndruck und verhindert, dass sich Nervenwasser anstaut und gesundes Hirngewebe abdrückt.
Um verbliebene Tumorreste zu eliminieren, ist im Anschluss oft eine Bestrahlung und/oder Chemotherapie sinnvoll. Diese Form der Behandlung zielt meist nicht auf eine vollständige Heilung ab, vielmehr stehen Schmerzlinderung und Erhaltung der Lebensqualität im Vordergrund.
Strahlentherapie bei Gehirntumor
Die Strahlentherapie kann entweder in Kombination mit anderen Behandlungsverfahren oder allein zum Einsatz kommen. Die Strahlen schädigen sowohl gesunde Zellen als auch Tumorzellen. Tumorzellen reagieren auf die Bestrahlung allerdings empfindlicher als gesunde, sodass vor allem die Tumorzellen Schaden nehmen.
Die vorgesehene Strahlendosis erhalten Patient*innen häufig über einen Zeitraum von einigen Wochen, verteilt auf mehrere Sitzungen. Die Bestrahlung mit mehreren, aber geringen Dosen hat den Vorteil, dass die Nebenwirkungen geringer sind.
Es ist auch möglich, einmalig eine höhere Strahlendosis zu verabreichen – mithilfe der sogenannten Radiochirurgie (auch: stereotaktische Strahlentherapie). Dabei ist es besonders wichtig, die exakte Lage des Tumors zu kennen, damit die Strahlen zielgerichtet wirken können. Bei der Behandlung wird der Kopf der Person mit einem Rahmen fixiert. Anhand von Bildaufnahmen (etwa CT- und MRT-Bilder) errechnet ein Computer die Lage des Gehirntumors und richtet Strahlen mit höherer Dosis ausschließlich auf diese Stelle. Dadurch stirbt das Krebsgewebe im besten Fall ab.
Welche Nebenwirkungen können bei einer Strahlentherapie auftreten?
Eine Strahlentherapie kann verschiedene Beschwerden nach sich ziehen. Als häufigste Nebenwirkung schwillt das Hirngewebe vorübergehend an, welches den Hirntumor umgibt. Weitere Beschwerden, die im Rahmen einer Strahlentherapie auftreten können, sind zum Beispiel
- zeitlich begrenzter Haarausfall, der sich nach der Behandlung wieder bessert,
- leichte lokale Hautreizung an der Stelle, wo die Strahlung die Haut durchdringt,
- Müdigkeit,
- Erschöpfung,
- leichte Kopfschmerzen oder
- Konzentrationsstörungen.
Chronische, also langanhaltende Nebenwirkungen sind selten.
Behandlung mit Chemotherapie
Bei der Chemotherapie erhalten Patient*innen spezielle Medikamente, sogenannte Zytostatika, welche die Zellteilung hemmen. Sie wirken besonders gut bei Krebszellen, da sich diese schneller teilen als gesunde Zellen. Allerdings schädigt die Chemotherapie auch gesunde Zellen, was zu verschiedenen Nebenwirkungen führen kann.
Eine Chemotherapie stellt nur bei bestimmten Arten eine erfolgversprechende Behandlung dar. Ein Beispiel hierfür sind Lymphome des Gehirns. Dabei werden die Zytostatika entweder über die Vene ins Blut oder über einen Einstich in den Rückenmarkskanal (Lumbalpunktion) in das Nervenwasser (Liquor) verabreicht.
Welche Nebenwirkungen können auftreten?
Zu möglichen Nebenwirkungen zählen etwa:
- Übelkeit
- Erbrechen
- Entzündungen der Mundschleimhaut
- Durchfall
- Haarausfall
Supportive Therapie bei Gehirntumoren
Neben der eigentlichen Behandlung des Hirntumors erhalten Betroffene auch eine sogenannte supportive Therapie. Dabei steht im Fokus, mögliche Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Übelkeit zu behandeln. So soll die Lebensqualität von Patient*innen gesteigert werden. Auch eine psychoonkologische Therapie, also psychologische Unterstützung speziell für Betroffene mit Krebs, kann eine hilfreiche ergänzende Maßnahme sein.
Hirntumor: Verlauf und Prognose
Verlauf und Prognose sind individuell und abhängig davon, aus welchem Gewebe der Tumor besteht, wie groß er ist und in welcher Hirnregion er sich befindet.
Eine grobe Einschätzung ist mit der Schweregrad-Einteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) möglich. Der WHO-Grad I entspricht einem gutartigen, langsam wachsenden Gehirntumor mit günstiger Prognose. Bei einer Geschwulst mit WHO-Grad IV handelt es sich dagegen um einen besonders bösartigen und schnell wachsenden Hirntumor mit entsprechend ungünstiger Prognose.
- WHO-Grad I: gutartig, langsames Wachstum, sehr gute Prognose
- WHO-Grad II: noch gutartig, Risiko des Übergangs zu bösartigem Tumor
- WHO-Grad III: bereits bösartig
- WHO-Grad IV: sehr bösartig, schnelles Tumorwachstum, schlechtere Prognose
Wichtig: Die WHO-Einteilung hilft Fachleuten der Neurochirurgie auch dabei, die individuell passende Therapie zu bestimmen. Ein Gehirntumor Grad I lässt sich beispielsweise oftmals operativ heilen.
Bildet sich nach der Behandlung erneut ein Tumor, sprechen Fachleute von einem Rezidiv. Ein Rezidiv wirkt sich meist ungünstig auf die Prognose aus. Deshalb ist es wichtig, einen erneuten Tumor möglichst frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Nach Abschluss der Therapie sind im weiteren Verlauf daher regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen zur Früherkennung nötig.